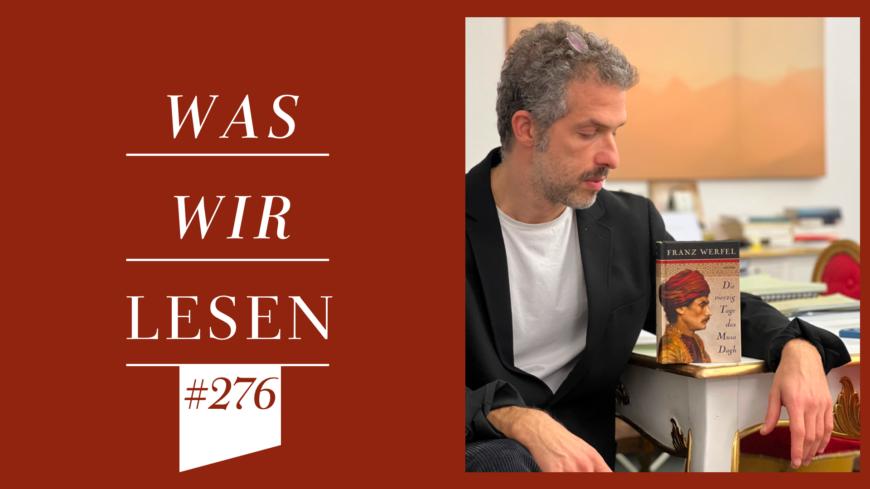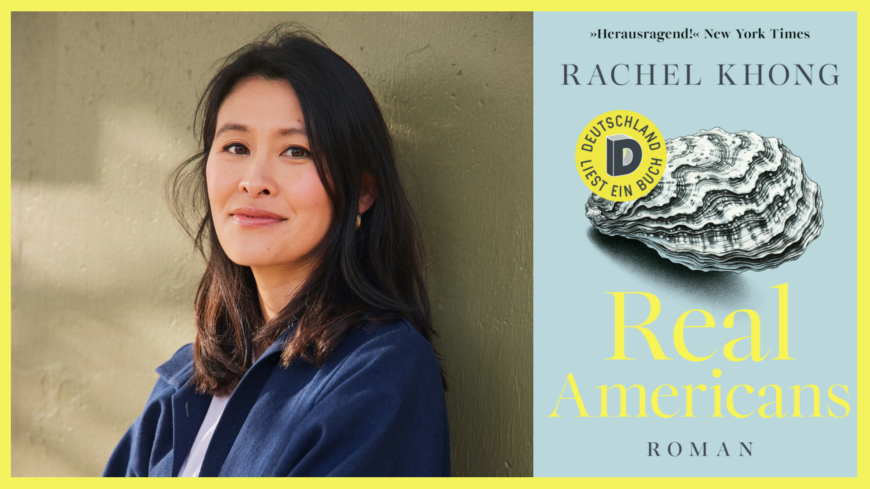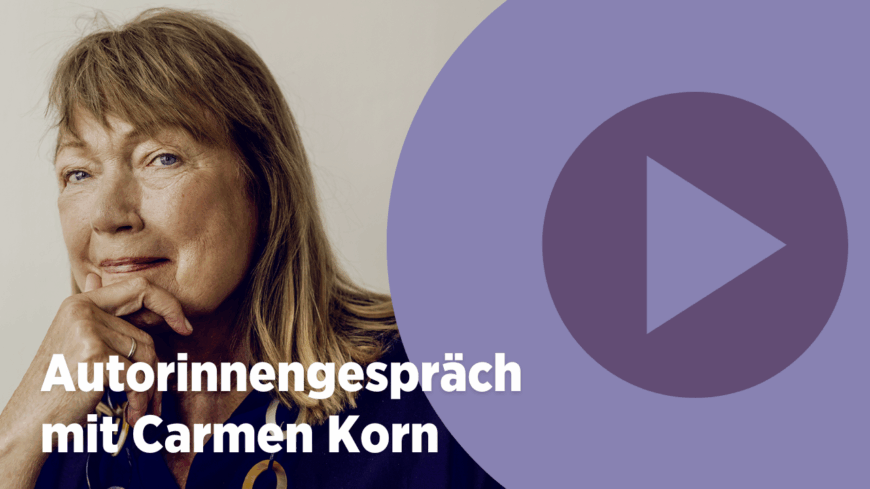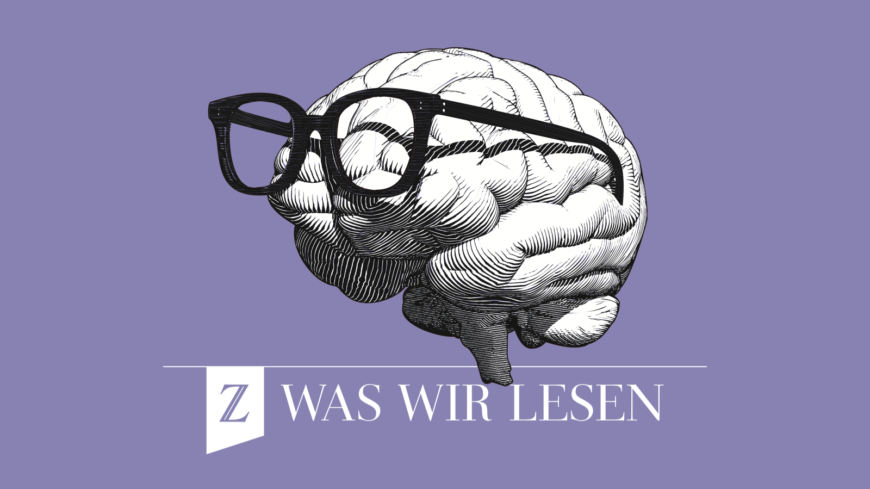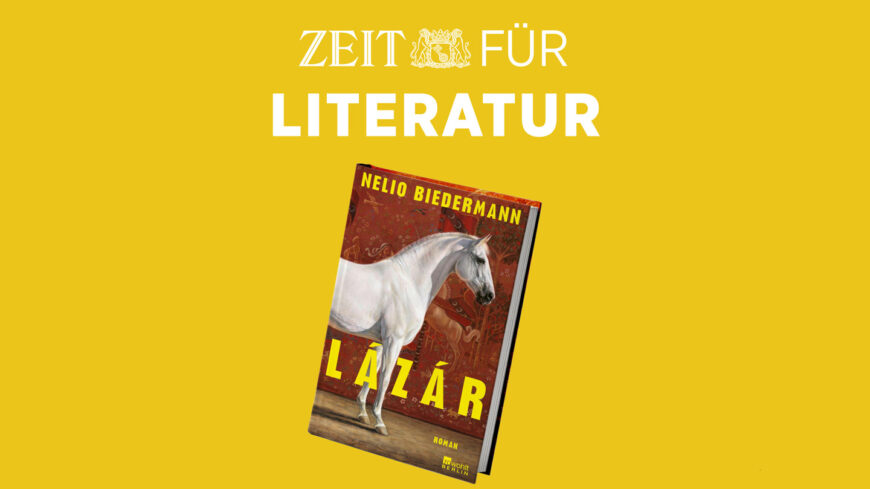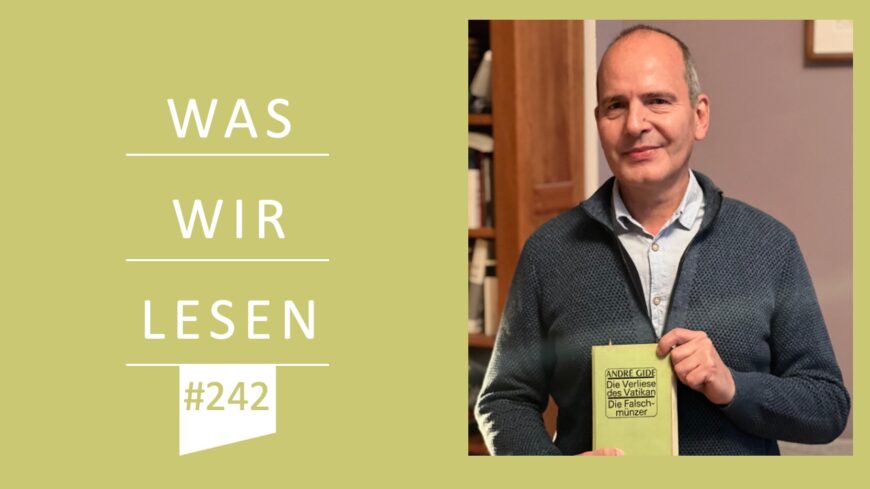
Der Journalist und Autor Jens Bisky über »Die Falschmünzer« von André Gide:
»Der Roman verbindet menschenfreundliche Lebensklugheit mit literarischem Virtuosentum«
DasWelches Buch hat Sie kürzlich richtig begeistert?
Im Sommer fiel mir beim Staubwischen ein Buch in die Hände, zu dem ich vor über vierzig Jahren schon einmal gegriffen hatte, weil es, wie mir Freunde damals sagten, ein Reigen homosexueller Liebesgeschichten war: André Gides »Die Falschmünzer« aus dem Jahr 1925. Im DDR-Verlag Volk und Welt war die erste deutsche Übersetzung – von Ferdinand Hardekopf – wieder aufgelegt worden. Nun, Jahrzehnte später, fing ich an zu lesen und war sofort gefangen. Der Roman verbindet menschenfreundliche Lebensklugheit mit literarischem Virtuosentum, das eine ist ohne das andere nicht zu haben.
Worum geht es?
Pariser Gymnasiasten suchen ihren Weg ins Leben, raus aus der Stickluft der Konvention, fort vom sinnlosen So-Weiter. Sie wollen gesehen werden, sich auszeichnen, das Echte vom Falschen unterscheiden. Die Welt der Väter verlangt Folgsamkeit von ihnen und bietet doch kaum Erstrebenswertes, bestenfalls Abenteuer, schnellen Ruhm, Komfort. In ihrer Auflehnung entwickeln die Halbwüchsigen auch grausame, eitle, böse Charakterzüge. Am Ende steht ein Tod, halb Mord, halb Suizid, der hätte verhindert werden können.
Können Sie sich mit einer Figur aus dem Buch identifizieren?
Am ehesten mit Edouard, dem älteren Schriftsteller, der im Roman an seinem Roman »Die Falschmünzer« arbeitet, der viel beobachtet, sich regelmäßig falsch entscheidet. Einträge aus Edouards Tagebüchern kommentieren das Geschehen und treiben es voran. Aber man sollte sich in diesem Roman auf das Spiel mit unterschiedlichsten Perspektiven einlassen und auf die grandiose Parodie romanhafter Verwicklungen: Versteckte Briefe werden entdeckt, der eigene Vater ist nicht der Erzeuger, ein Gepäckschein geht verloren, es häufen sich unwahrscheinliche Begegnungen; eine bessergestellte Jugendbande bringt falsche Münzen in Umlauf. In Gides Paris des frühen 20. Jahrhunderts geht es zu wie in Seefahrergeschichten. Die platte Vorstellung folgerichtiger Entwicklung wird auf diese Weise ironisiert – und man ist eingeladen, die Perspektive einer jeden Person einzunehmen.
Was haben Sie über sich gelernt?
Gelernt habe ich vor allem, wie großes Vergnügen mir nichtrealistische Romane bereiten, wie sehr ich Geschichten mag, in denen die Kunst, nicht das Leben Regie führt. Daraus folgt Neugier auf die Art, in der wir von der Welt und unserem Weg in ihr erzählen, und die nicht neue, aber beunruhigende Einsicht, wie nah beieinander Zärtlichkeit und Grausamkeit liegen, dass wir alle seltsam gemischte Wesen sind, viele Anlagen in uns tragen. Was sorgt dafür, welche sich entwickeln?
Und was lesen Sie sonst so?
Berufsbedingt viele Sachbücher, wissenschaftliche Monografien, privat gern Biografien, Memoiren, Tagebücher – und Dramen. Wort, Widerwort, Vorhang – dabei erhole ich mich am besten.
Jens Bisky, 1966 in Leipzig geboren, hat über seine frühen Jahre in der viel beachteten Autobiografie »Geboren am 13. August. Der Sozialismus und ich« Auskunft gegeben. Er studierte Kulturwissenschaft und Germanistik und wurde mit einer Arbeit über Architekturästhetik promoviert. Als Journalist schrieb er unter anderem für das Feuilleton der »Süddeutschen Zeitung« und ist heute geschäftsführender Redakteur von »Mittelweg 36« und »Soziopolis«, den Publikationen des Hamburger Instituts für Sozialforschung. 2019 veröffentlichte er »Berlin. Biographie einer großen Stadt«. Der Maler Norbert Bisky ist sein jüngerer Bruder. Sein neuestes Buch »Die Entscheidung. Deutschland 1929 bis 1934« war für den Preis der Leipziger Buchmesse 2025 nominiert.